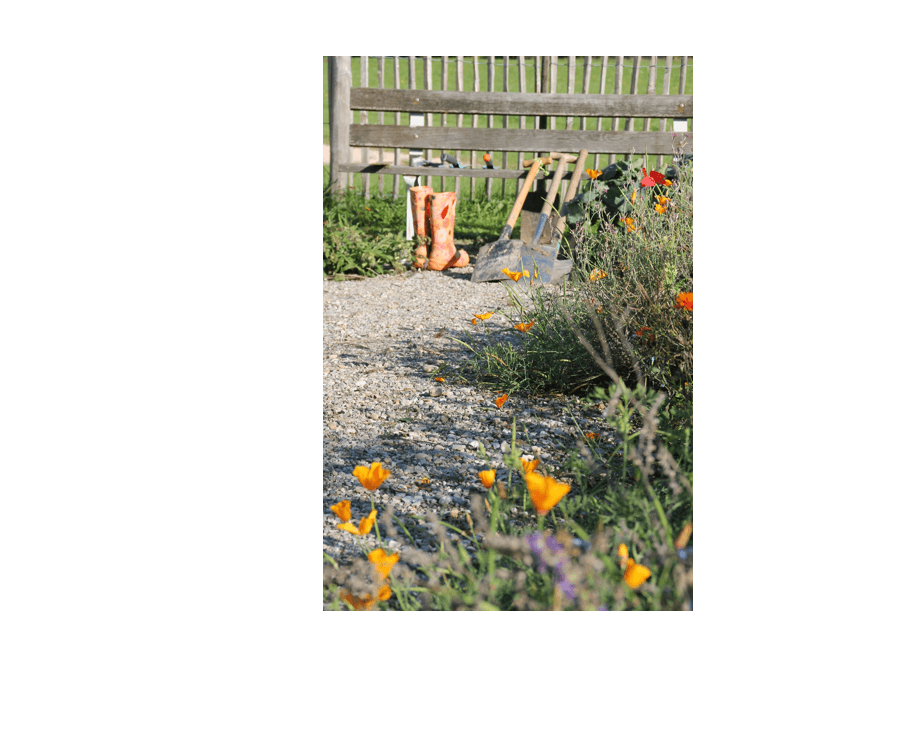Infobox
Veranstalter
Campus St. MichaelOrt
Campus St. Michael
Wasserzone
Die Wasserzone ist nach Süden ausgerichtet und liegt am Fuß der Kräuterspirale, damit ist sie direkt am Teich und ist folglich die nässeste aller Zonen. Der Boden besteht zu 100% aus Gartenerde. Kräuter die sich in dieser Zone wohlfühlen sind Sumpfkräuter, wie Brunnenkresse, Kalmus, Wasserminze und Bachbunge.
Die Wasserminze, oder mentha aquatica, gehört zu der Familie der Lippenblütler. Sie ist mit der Pfefferminze verwandt, ist aber milder im Geschmack. Da sie weniger Menthol enthält und ist dadurch besser für Kinder und Rezepte, in denen die Pfefferminze zu dominant wäre, gut geeignet. Andere Inhaltsstoffe der Wasserminze sind ätherische Öle, Bitterstoffe, Enzyme, Gerbstoffe, Limonen, Menthofuran und Pinen. Diese Inhaltstoffe sind für die folgenden Heilwirkungen der Wasserminze zuständig: antimikrobielle, antivirale und antioxidative Fähigkeiten, sie löst Krämpfe, lindert Schmerzen und stimuliert das Ausschütten von Galle, verkleinert Gefäße und behindert das Ausschütten von Sekreten. Man verwendet die Blätter, welche von April bis August geerntet werden können, und die Blüten, welche von Juli bis Oktober blühen und von Juli bis September geerntet werden können.
Was kann man mit Wasserminze alles machen? – Ganz besonders gut ist der Tee, man kann auch ein Öl aus der Wasserminze herstellen. Zum Verzehr eignet sich die Wasserminze in Sirup, Limonaden, Likören, Salaten, Süßspeisen und wenn in Rezepten Pfefferminze drinnen steht und diese zu intensiv ist, kann diese durch Wasserminze ersetzt werden (Wie zum Beispiel: Minze-Joghurt-Dip).
Kalmus, oder acorus calamus, gehört zur Familie der Aronstabgewächse, der Araceae. Seine volkstümlichen Namen sind: Ackermann, Ackerwurz, Bajonettstangen, Kalmuswürze und deutscher Ingwer. Kalmus wird bei Appetitlosigkeit, Blähungen, Darmkrämpfen, Magengeschwüre, Magenkatarrh, Mundschleimhaut Entzündungen, Rauchentwöhnung, Verstopfung und zahnenden Kindern verwendet. Dabei wird nur der Wurzelstock verarbeitet, welcher von März bis April und von September bis November geerntet werden kann. Die Inhaltsstoffe der Wurzel sind der Bitterstoff Acorin, Akoretin (Harz), Kalamin-Cholin, Trimethylamin, Kalmusgerbsäure, Schleim, Terpene, Calamenol und Palmitinsäure.
Was kann man aus Kalmus alles machen? – Bei Rauchentwöhnung und zahnenden Kindern soll die betroffene Person auf der Wurzel herumkauen. Man kann einen Aufguss mit kaltem oder heißen Wasser machen oder eine Tinktur ansetzten. In der Küche kann Kalmus wie Ingwer verwendet werden.
Feuchtzone
Die Feuchtzone folgt der Wasserzone und ist somit noch nass aber nicht so durchnässt, wie die Wasserzone. Der Boden besteht zu 50% aus Gartenerde und zu 50% aus Kompost. Hier fühlen sich Kräuter wohl, welche einen nährstoffreichen und nassen Boden bevorzugen. Dazu gehören Kerbel, Petersilie, Schnittlauch, echtes Johanneskraut und Dill.
Das echte Johanneskraut, oder hypericum perforatum, gehört zur Familie der Johanniskrautgewächse. Es besitzt volkstümliche Namen wie Tüpfel-Hartheu, Tüpfel-Johanniskraut, Konradskraut und Blutkraut. Es wird bei Stress, Depressionen, nervösen Unruhezuständen, Wundbehandlung, Verbrennungswunden, trockener Haut, Schwellungen, Gicht und Gastritis verwendet, da es folgende Heilwirkungen besitzt: es hat antidepressive, stressmindernde und schlaffördernde, entzündungshemmende, wundheilungsfördernde und antibakterielle Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten werden in den Inhaltsstoffen Hypericine, Pseudohypericin, Flavonoide, Bioflavone, Hyperforin, Adhyperforin und ätherische Öle begründet. Es werden die Blätter, Triebe und Blüten verwendet, welche von Mai bis Oktober geerntet werden können.
Was kann man aus echtem Johanneskraut alles machen? – Für Hautprobleme kann aus echtem Johanneskraut das sogenannte „Rotöl“ hergestellt werden, zur Einnahme kann ein Tee aufgebrüht werden. Ebenfalls kann man ein „Schlaf-Wohl-Kissen“ herstellen, welches man sich neben sein Kopfkissen oder auf den Nachtisch legt und dann leichter einschlafen kann.
Die Petersilie, oder petroselinum crispum, gehört zur Pflanzenfamilie der Doldenblütler. Man verwendet die Blätter, welche ganzjährig geerntet werden können, und selten die Wurzel. Die Petersilie besitzt folgende Heilwirkungen: sie ist diuretisch, antiseptisch, entzündungshemmend, appetitanregend, leicht angst- und stresslösend, teilweise antimikrobiell und blähungswidrig, und wird deshalb bei Erkrankung der Nieren, Magen-Darm-Erkrankung, Menstruationsbeschwerden, Mundgeruch, Diabetes, Dermatitis und Störungen der Fettverdauung oder Leberfunktionsstörungen hergenommen. Die Inhaltsstoffe, welche für die Heilwirkungen verantwortlich sind, sind: die ätherischen Öle Apiol, Myriticin, Pinen, Limonen und Phellandren, Flavonoide, Isorhamnetin, Apigenin, Luteolin und Kaempferol. Sie ist aber nicht nur eine Heilpflanze, sondern auch ein Würzkraut und wird dort besonders in Salaten, Pesto, Kräuterbutter und –quark, Suppen und Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichten verarbeitet.
Was kann man aus Petersilie alles machen? – Man kann die Petersilie entsaften und diesen Saft dann mit milden Gemüse- oder Fruchtsäften vermischen, ebenso kann man sie in einem Smoothie verwerten. Man kann auch Petersilien-Tee machen. Die Petersilie passt wunderbar in Soßen, Suppen, Dips, Pestos und Brotaufstrichen, sie kann aber auch zu vielen anderen Gerichten hinzugefügt werden, dabei als frischer erst zum Schluss und als getrockneter dagegen schon früher.
Normalzone
Die Normalzone folgt der Feuchtzone und ist dem unseren heimischen Feuchtigkeitsbedingungen am ähnlichsten, sie ist weder nass noch übermäßig trocken. Die Bodenbeschaffenheit ist 30% Gartenerde, 40% Kompost und 30% Sand. Kräuter welche sich in dieser Zone wohlfühlen sind: Basilikum, Kümmel, Oregano, Ysop und Zitronenmelisse.
Der Ysop, oder hyssopus officinalis, gehört zur Familie der Lippenblütler. Er ist unter verschiedenen Namen bekannt, wie Weinespe, Eisenkraut, Hizkopf, Ipsenkraut, Duftisoppe, Bienenkraut, Essigkraut und Josefskraut. Es werden die Blätter verwendet, welche von Juni bis August geerntet werden können. Diese können dann bei Magen- und Darmerkrankungen, Zahnfleischentzündungen, grippalen Infekte und Nervosität eingesetzt werden, da der Ysop folgende Heilwirkungen besitzt: er ist entzündungshemmend, schweißhemmend, menstruationsfördernd, gallefördernd und leicht abführend. Diese Heilwirkungen begründen in seinen Inhaltsstoffen: ätherisches Öl, Flavoglycosise (Hesperidin, Diosmin), Gerbstoffe, Cholin, Apfelsäure, Zucker, Harz und Gummi. Aber der Ysop ist nicht nur ein Heilkraut, sondern auch ein Würzkraut, hier wird er in Salaten, Quark, Braten und Soßen verwendet.
Was kann man aus Ysop alles machen? – Man kann sich einen Tee aufgießen oder den Ysop in Salaten, Soßen und Suppen verwerten. Er macht sich ebenso sehr gut in Kartoffel-, Pilz- oder fette Fleisch- und Fischgerichte. Da der Ysop sehr gut mit Knoblauch und Frühlingszwiebeln harmoniert kann man einen sehr guten Kräuterbutter herstellen oder ihn in Pastarezepte verwenden. Hier muss man jedoch beachten, dass man ihn nur in Maßen hinzufügt und ihn nicht mit kocht, da er zwar einen sehr intensiven Geschmack hat aber diesen verliert wenn er erhitzt wird.
Die Zitronenmelisse, oder melissa officinalis, gehört zur Familie der Lippenblütler, der Lamiaceae, und ist somit mit anderen Heilkräutern, wie Salbei, Rosmarin oder Thymian, verwandt. Sie ist auch unter anderen Namen wie Melisse, Zitronenkraut, Gartenmelisse, Wanzenkraut, Citronelle, Bienenkraut und Frauenwohl bekannt. Es werden die Blätter verwendet, welche von Juni bis September geerntet werden können. Diese kann man dann bei Angststörungen, Schlafstörungen, Erschöpfungszuständen, Nervösität, psychisch bedingte Herzbeschwerden, allgemeinen Magen-Darm-Problemen, Appetitlosigkeit, Krämpfen, Blähungen, Durchfall, Übelkeit in der Schwangerschaft, Insektenstiche und Menstruationsstörungen einsetzen, da die Zitronenmelisse folgende Heilwirkungen besitzt: sie ist stresslindern, angstlösend, einschlaffördernd, krampflösend, blähungswidrig, antibakteriell, teilweise pilzhemmend und antiviral und ist chloeretisch (sie regt die Produktion von Gallenflüssigkeit an). Diese Heilwirkungen lassen sich auf folgenden Inhaltsstoffen der Zitronenmelisse begründen: ätherische Öle (Citral, Geraniol, Nerol), Rosmarinsäure, Flavonoide (Luteolin, Apigenenin) und Kaffeesäure. Auch sie ist nicht nur ein Heilkraut, sondern auch ein Würzkraut und kann Süßspeisen, Fisch- und Kartoffelgerichten, Pesto, Salate und Marinaden beigefügt werden.
Was kann man aus Zitronenmelisse alles machen? – Man kann sich einen Tee aufbrühen, ein Flüssig- oder Trockenextrakt und ein Öl herstellen um ihre heilenden Fähigkeiten zum Wirken zu bringen. In der Küche kann sie in etlichen Süß- und Milchspeisen, Bowle, Limonaden oder auch pikanten Fisch-und Kartoffelgerichten, sowie in Salaten, Pestos und Marinaden verwertet werden. Auch hier sollte man beachten, dass man die Blätter nicht großer Hitze aussetzt, da sie dabei ihren Geschmack verlieren.
Trockenzone
Die Trockenzone ist die trockenste aller Zonen und liegt am oberen Ende der Kräuterspirale, sie wird damit auch am meisten durch die Sonne beschienen. Der Boden besteht zu 50% aus Gartenerde und 50% aus Sand. In dieser Zone fühlen sich mediterrane Kräuter sehr wohl, darunter sind Majoran, Sommer-Bohnenkraut, Rosmarin, Weinraute, Estragon, Liebstöckel und Currykraut.
Der Liebstöckel, oder levisticum officinale, gehört zur Familie der Doldenblütler, der Apiaceae. Er ist auch unter den Namen Badkraut, Gebärmutterkraut, Maggikraut, Nervenkräutel, Rübenstöckel und Schluckwehrohr bekannt. Es werden die Blätter, welche im Frühjahr geerntet werden, die Wurzeln, welche im zeitigen Frühjahr oder im Spätherbst geerntet werden, und die Samen, welche im Spätsommer geerntet werden, verwendet. All dies kann angewendet werden bei Krämpfen, Harnwegsinfekten, Nierenbeschwerden, Menstruationsbeschwerden, Ekzeme, Pickel und Rheuma, da der Liebstöckel folgende Heilwirkungen hat: er ist anregend, blutstillend, harntreibend, krampflösend, schleimlösend, schweißtreibend, Stoffwechsel anregend und menstruationsfördernd. Diese Heilwirkungen gründen in den Inhaltsstoffen des Liebstöckel, welche sind: ätherische Öle, Angelikasäure, Apiol, Apfelsäure, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Fette, Gummi, Harze, Invertzucker, Kampfer, Carvon, Isvalerinsäure, Cumarine, Myristicin und Umbelliferon. Doch der Liebstöckel ist weniger als Heilkraut bekannt, sondern als Würzkraut und wird so mehr in der Küche verwertet.
Was kann man aus Liebstöckel alles machen? – Man kann aus den Blättern, Wurzeln und Samen Tee herstellen, wobei man die Blätter auch roh essen kann. Ebenso lässt sich eine Tinktur oder ein Likör erstellen. In der Küche wird er besonders in Suppen, Eintöpfen und deftigen Fleischgerichten verwendet. Die Samen speziell werden zu Käse, als natürlicher Aromageber, hinzugefügt oder wie Kümmel in Brot verbacken. Auch hier sollte der Liebstöckel nicht zu großer Hitze ausgesetzt werden, da sonst der Geschmack weniger intensiv ausfallen wird.
Der Rosmarin, oder rosmarinus officinalis, gehört zur Familie der Lippenblütler, der Lamiaceae. Er ist auch unter den Namen Antonkraut, Brautkraut, Hochzeitsbleaml, Kranzkraut, Meertau, Reslmarie, Rosmarein und Weihrauchkraut bekannt. Man benutzt die Nadeln und Blüten, welche von April bis Mai geerntet und bei Appetitlosigkeit, Atembeschwerden, Blähungen, Durchfall, Ekzemen, Erschöpfungszustände, Gicht, Haarausfall, Herzschwäche, Hämorrhoiden, Ischias, Kopfschmerzen, Magenschwäche, Migräne, Nervenentzündungen, Nervöse Unruhe, Neuralgien, niedriger Blutdruck, Rheuma, Schwäche, Verdauungsstörungen, Wechseljahrsbeschwerden, hartnäckige Hautausschläge, nervöse Herzbeschwerden, nervöse Kreislaufbeschwerden und schwacher Menstruation. Der Rosmarin kann bei all diesen Beschwerden helfen, da er folgende Heilwirkungen besitzt: er ist adstringierend, anregend, antibakteriell, entspannend, entzündungshemmend, krampflösend, pilztötend, schmerzstillend, tonisierend und menstruationsfördernd, welche durch die folgenden Inhaltsstoffe hervorgerufen werden: ätherische Öle, Terpene, Thymol, Verbanol, Gerbstoffe, Gerbsäure, Kampfer, Bitterstoff, Beta-Sitosterol, Flavone, Salicylate und Saponine. Auch dieses Heilkraut ist ebenso ein Würzkraut, wobei es mit Fleischgerichten, Käse und Gemüse verwertet wird.
Was kann man aus Rosmarin alles machen? – Die Blüten passen gut als Garnierung auf einem Salat, die rohen Zweige oder Nadeln können mit Speisen mitgekocht oder in Essig oder Öl eingelegt werden. Er passt sowohl zu Fisch, Fleisch, Gemüse, Käse und Süßspeisen, wobei sowohl die Nadeln als auch die Blüten verwendet werden können.
Veranstaltungen zu diesem Projekt
Hier finden Sie die verschiedenen Veranstaltungen zu unserem Projekt. Nehmen Sie sich die Zeit und stöbern Sie ein wenig. Vielleicht ist ja etwas passendes für Sie dabei.